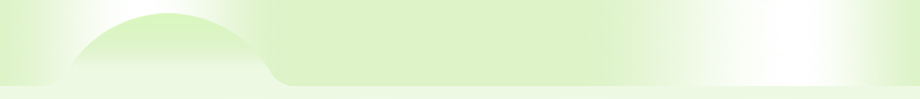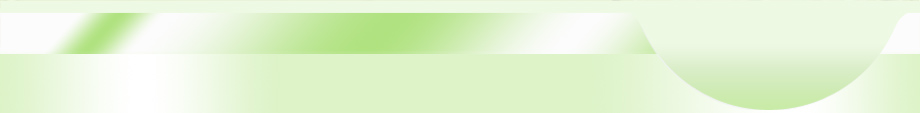
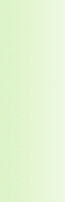
 |
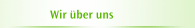 |
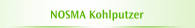 |
 |
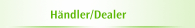 |
 |
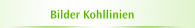 |
 |
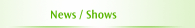 |
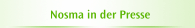 |
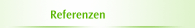 |
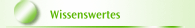 |
 |
 |
 |
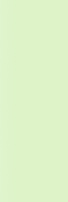
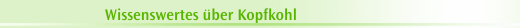
| Brassica oleracea L. var.capitata Synonyme: Weißkohl: Weißkraut, Kappes, Komst, Weißkabis Rotkohl: Rotkraut, Blaukraut, Blaukohl, Rotkabis Wirsing: Welschkohl, Wirschkohl, Savojerkohl, Herkunft: Die wilde Form aller Kohlarten wächst an den Küsten des Mittelmeeres und an der europäischen Atlantikküste. Weil auch der Weißkohl das maritime Klima sowie Gebiete mit hohen Niederschlägen liebt, sind bedeutende Anbauländer ua die Niederlande, Frankreich, Dänemark, England, Griechenland und, an exponierter Stelle, Deutschland.Dithmarschen ist das größte Kohlanbaugebiet Europas. Weißkohl ist aufgrund seiner guten Lagerfähigkeit ganzjährig erhältlich. Im Unterschied zum Weißkohl hat der Rotkohl kleinere, sehr feste Köpfe.Der Rotkohl hat seine Heimat im Mittelmeerraum und Kleinasien.Angebaut wird er vor allem in Belgien,in den Niederlanden,Skandinavien, Polen,Frankreich,Italien und natürlich bei uns in Deutschland.Hauptanbaugebiete in Deutschland sind Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.Sowie Weißkohl ist auch Rotkohl ganzjährig verfügbar. Kohlanbau Dithmarschen: Dithmarschen ist seit dem späten 19. Jahrhundert Europas größtes zusammenhängendes Anbaugebiet für Kohl. Auf, je nach Jahr, etwa 2500 bis 3000 Hektar werden ungefähr 80 Millionen Kohlköpfe angebaut. Die Dithmarscher Kohltage ist ein seit 1986 stattfindendes regionales Fest im Kreis Dithmarschen, das im späten September stattfindet. Das den süddeutschen Weinfesten nachempfundene Fest soll die Bedeutung des Kohlanbaus für die Region würdigen und zudem den Tourismus fördern. Ernährungspsyschologische Bedeutung: Kopfkohl galt bis zur Mitte dieses Jahrhunderts als das in weiten Teilen Europas wichtigste Gemüse.Als Frisch- und Lagerprodukt, verarbeitet als Sauerkraut, für Koch- und Salatgemüse läßt es sich vielseitig verwenden. Sauerkraut war früher im gesamten Winterhalbjahr die einzige Vitamin-C-Quelle bei Gemüse. Einfacher Anbau,hohe Ertragsleistung und lange Lagerfähigkeit förderten den Absatz von Kopfkohl als Nahrungsmittel. Wirtschaftliche Bedeutung: Mit seinem beachtlichen Produktionsumfangs ist Kopfkohl von großer Bedeutung. Hinsichtlich der weltweit erzeugten Menge liegt er nach Tomaten an zweiter Stelle aller Gemüsearten.Etwa ein sechstel der Welt- anbaufläche entfällt auf Europa.Die Weltweit bedeutensten Anbauländer von Kopfkohl sind Korea,China, die USA,Russland und Polen.In Deutschland wird Weisskohl auf einer Fläche von ca 7700 ha und Rotkohl auf einer Fläche von ca 3600 ha angebaut.Mehr als 50% der jährlichen Weißkohlernte wird von der Industrie zu Sauerkraut verarbeitet.Weißkohl gehört zu den wenigen Gemüsearten in Deutschland mit nennenswertem Exportumfang. Fruchtfolge: Um der Kohlhernie vorzubeugen, muss zwischen Kreuzblütlern eine Anbaupause von mindestens vier Jahren eingehalten werden. Wo Kohlarten in der Fruchtfolge vorkommen, sollten Kreuzblütlerarten, wie Senf oder Ölrettich, als Gründüngung nicht angebaut werden. Alle Kohlarten gedeihen in einer Bio-Fruchtfolge am besten nach Umbruch eines einjährigen Leguminosengemenges. Stehen Kohlarten nicht an dieser privilegierten Stelle in der Fruchtfolge, so ist wenigstens eine Leguminosen-Zwischenkultur als Vorfrucht empfehlenswert. Anbauformen: Der großflächige, feldmäßige Anbau von Kopfkohl für die Verarbeitungsindustrie findet in landwirtschaftlichen Betrieben statt, der Anbau von Frühkopfkohl sowie von Kopfkohl für den Frischmarkt überwiegend im Intensivanbau der Gemüsebaubetriebe. Frühe Pflanzungen kann man zeitweilig zur Ernteverfrühung mit Vlies oder Lochfolie abdecken. Die meisten der heute angebauten Sorten sind Hybriden. Der Frischmarkt verlangt derzeit kleine Köpfe mit frischgrüner, einheitlicher Qualität.Teilweise sind auch Kopfgewichte von nur 1 kg gefragt. Bei Wirsing ist auch die Kopffarbe für den Verkauf entscheident. Pflanzung: Für frühe Ernten im Juni sind standortabhängig Pflanztermine zwischen Anfang und Ende März möglich. Pflanzweiten und Bestandsdichten richten sich nach dem Verwendungszweck. Beim PfIanzen ist darauf zu. achten, daß sich die Jungpflanzen möglichst senkrecht in der gewünschten Tiefe im Boden befinden. Vor dem Pflanzen sind die Jungpflanzen durchdringend zu wässern. Bei Trockenheit im Sommer geschieht das Beregnen unmittelbar nach dem Pflanzen. Düngung: Um eine ausreichende Ertragsbildung zu gewährleisten, muss die Kohlpflanze genügend Grünmasse aufbauen. Dafür braucht sie ausreichend Stickstoff: Brokkoli und Blumenkohl benötigen für einen guten Ertrag während der rund zwölf Wochen Standzeit auf dem Feld im Bio-Anbau pro Hektar rund 220 Kilogramm Stickstoff, während Kopfkohlarten, wie zum Beispiel Lagerkohl, in etwa 18 Wochen auch mit 160 Kilogramm Stickstoff einen ansprechenden Ertrag bilden können. Gute Voraussetzungen für eine ausreichende Stickstoffversorgung ist ein überjähriger Kleegrasbestand, welcher rechtzeitig umgebrochen wird. Wo Wirtschaftsdünger zur Verfügung stehen, kann eine Gabe mit gut verrottetem Mist (z.B. 20 t/ha) oder eine Güllegabe (1:1 verdünnt) von 30 m3 pro Hektar vor der Pflanzung, idealerweise über das geackerte Feld, ausgebracht werden. So kann der Phosphor- und Kaliumbedarf weitgehend gedeckt werden. Um den Stickstoff-Bedarf ausreichend abzudecken, werden weitere 80 bis 100 Kilogramm Stickstoff mit organischen Handelsdüngern ausgebracht. Unkrautregulierung: Kohlarten werden in der Regel über Jungpflanzen angebaut. Dies erleichtert die Unkrautregulierung wesentlich. Auf Parzellen mit großem Unkrautdruck kann mit der Pflanzbettbereitung eine Unkrautkur gemacht werden. Nach der Pflanzung wird, sobald das Unkraut im Keim- bis Zwei-Blattstadium ist, mit einer Scharhacke zwischen den Reihen bearbeitet. In den Reihen ist oft ein Durchgang von Hand notwendig. Sobald die Pflanzen gut verwurzelt sind, kann auch mit einer Fingerhacke in der Reihe gearbeitet werden. Ab 15 bis 20 Zentimeter Größe können Unkräuter durch Anhäufeln beseitigt werden. In intensiv gemüsebaulich genutzten Böden sind drei bis vier Hackdurchgänge üblich. Hacken bringt Luft in die oberen Bodenschichten und beeinflusst dadurch das Wachstum der Kulturen positiv. Krankheiten: Kohlhernie: Die Kohlhernie gilt im Kopfkohlanbau als die gefährlichste und am schwierigsten zu bekämpfende Krankheit.Ihr Erreger ist ein Schleimpilz,der sich im Inneren von Kohl- und sonstigen Wirtspflanzen vermehrt.An den Wurzeln kommt es zu dem typischen Krankheitsbild,den knollen- bis walzenförmigen Verdickungen.Die Ober- fläche der Wucherungen ist schorfig und teilweise zerklüftet.Befallenen Pflanzen neigen zu Kümmerwuchs und welken schnell,vor allem bei Trockenheit.Die sich später entwickelnden Dauersporen des Pilzes gelangen durch faulende Wurzeln in den Boden und können dort sechs bis acht,unter günstigen Bedingungen auch mehr als zehn Jahre überdauern.Bei vorhandenen Wirtspflanzen infizieren sich diese und verseuchen den Boden erneut.Nicht nur Wirtspflanzen,sondern auch Nichtwirtspflanzen können bei günstigen Temperatur-,Feuchte- und pH-Verhältnissen die Kohlhernie Dauersporen zum Auskeimen bringen. Das Sanieren kohlhernieverseuchter Flächen ist schwierig und langwierig.Es gelingt meist nur über langfriestige optimale Bodenpflege von sieben oder mehr Jahren.Dazu sind nach systematischen Bodenuntersuchungen vor allem die Bodenreaktion,Humus- und Nährstoffversorgung standort- und somit bedarfsgerecht zu gestalten. Kalkstickstoff verringert bei geringen Infektionsdruck den Befall.Der Erfolg von Kalkstickstoff beruht auf einer Kombinationswirkung von Cyanamid und Kalk und nicht ausschließlich auf der Cyanamidphase des Düngers. Vorbeugende Maßnahmen: -Anbaupause von mindestens vier Jahren einhalten. -kein Anbau auf staunassen Böden -Bei Boden-pH unter 6.5 aufkalken (Teilgaben vor der Kultur wirken besser als eine einmalige Gabe). -Gründüngungen mit Roggen oder Weidelgras (Lolium sp.) im Sommer können das Befallsrisiko senken. -Befallene Stellen, sofern möglich, zuletzt bearbeiten. Maschinen nach Gebrauch reinigen. -Bei Befall: Mindestens sieben Jahre den Anbau von allen Kreuzblütler-Arten unterbrechen. -resistente Sorten verwenden Direkte Maßnahmen: keine möglich Raupen: Kohleule (Mamestra brassicae), Kohlweißlinge (Pieris brassicae, P. rapae), Kohlmotte oder Kohlschabe (Plutella xylostella) Die Kohleule tritt in intensiven Kohlanbaugebieten ab Juni regelmäßig auf.Der Falter legt seine gelben bis grauen Eier meist blattunterseits in Gelegen ab.So zeigt sich zunächst ein Schabefraß an den äußeren Kohlblättern durch die Raupe der Kohleule.Später vereinzeln sich die meist braunen,bis zu 40 mm großen Raupen über mehrere Pflanzen,verursachen Lochfraß und bohren sich tief in die Kohlköpfe ein. Raupenbesatz,Kotverschmutzung und nachfolgende Fäulnis entwerten den Kopfkohl.Die im Juli bis August vorkommende zweite Raupengeneration verursacht meist den Hauptschaden.Ein Teil der Puppen läßt sich durch frühe Bodenbearbeitung im Frühjahr zerstören. Vorbeugende Maßnahmen: -Bodenbearbeitung im frühen Frühjahr dezimiert überwinternde Puppen. -Anbau auf windoffenen Parzellen. -Parasitierende Nutzinsekten (Schlupfwespen) durch Anlegen von extensiven Wiesen und Buntbrachen (Blühstreifen) in unmittelbarer Parzellennähe fördern. -Kulturen vor der ersten Eiablage mit Insektenschutznetz (maximale Maschenweite 1,3 Millimeter) bedecken (nicht empfehlenswert bei hohen Temperaturen wegen Hitzestau). -Zur frühzeitigen Befallserkennung Bestände regelmäßig kontrollieren. Mehlige Kohlblattlaus (Brevicoryne brassicae) Die Mehlige Kohlblattlaus entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Hauptschädling im Kohlanbau. Sie verursacht insbesondere bei trockenem Wetter größere Schäden.Diese entstehen durch Besaugen der Blätter.Da die Blattläuse bevorzugt Herzblätter besiedeln,können bei frühem Befall Blatt- und Kopfbildung völlig ausbleiben.Neben Saugschäden übertragen die Blattläuse auch Viren.Die zwischen 2,2 bis 2,5 mm großen, hellgrün gefärbten,mit zwei Längsreihen kleiner schwarzer Querstreifen versehenen Blattläuse erscheinen durch ihre Wachspuderungen hellgrau.Die Mehlige Kohlblattlaus ist nicht wirtswechselnd und überwintert als Ei an Ernterückständen,Kohlsamenträgern und bei trocken-warmen Spätsommern auch an Raps.Der stärkste Zuflug zu den Kohlbeständen findet meist im Juni bis Anfang Juli statt,während das größte Schadauftreten in die Monate Juli und August fällt.Im Laufe eines Jahres entstehen sieben bis acht Generationen.Wärme und Trockenheit fördern die Entwicklung der Blattläuse. Vorbeugende Maßnahmen: -Blattlausfreie Jungpflanzen verwenden. -Jungpflanzen im Anzuchtbeet (Freiland) mit Insektenschutznetzen (Maschenweite < 1.4 Millimeter) schützen. -Optimale Bodenstruktur und ausreichende Nährstoffversorgung (v.a. Kalium) -Mittelfristig: Förderung der natürlichen Nützlingspopulationen (parasitierende Schlupfwespen, Marienkäfer) durch Anlegen von an Gemüsefelder grenzende Buntbrachen (Blühstreifen). -Befallene Erntereste zerkleinern und einpflügen. -Bei Trockenheit Bewässerung, um Wachstum der jungen Pflanzen zu fördern. Kohlfliege (Delia brassicae) Die Kohlfliege gilt in Kohlanbaugebieten als der bedeutenste Schädling von Kopfkohl.Sie tritt in drei nicht scharf voneinander getrennten Generationen auf.Die ersten Fliegen erscheinen bei ansteigenden Temperaturen von Mitte April bis Anfang Mai.Die Eiablage beginnt eine Woche nach dem Schlüpfen der Imagines.Die Fliege legt Ihre Eier an den Wurzelhals der Pflanze oder in benachbarte Erdspalten ab. Die weißen Maden zerfressen Stengelgrund und Wurzeln.Stark befallene Pflanzen verfärben sich blaugrau, welken und sterben ab.Sie lassen sich leicht aus dem Boden ziehen.Als Bekämpfungsrichtwert im Feldbestand sieht man 5% der Pflanzen mit drei oder mehr Eiern an. Vorbeugende Maßnahmen: -Fruchtfolge: Anbaupause von vier Jahren einhalten und Nähe von vorjährigen Kohlfeldern meiden. -Kein frischer Mist direkt zur Kultur -Tief pflanzen -Fördern von räuberischen Nützlingen, wie Kurzflügler, Schlupfwespen und Spinnenarten durch Anlegen von dauerhaften Nützlingsstreifen (z.B. Buntbrachen) -Gut anhäufeln, um Seitenwurzelbildung zu fördern. -Zuflug von Kohlfliegen mit Insektenschutznetzen (Maschenweite 1,3 Millimeter) oder im Frühjahr mit Vliesabdeckung verhindern. -Regelmäßige Befallskontrolle (Eiablage am Wurzelhals) Kohlmottenschildlaus (Aleyrodes proletella) In den letzten Jahren hat die Kohlmottenschildlaus zunehmend Probleme verursacht, vor allem an Rosenkohl, Grünkohl und Wirsing. Die Schäden sind dabei weniger durch die Saugtätigkeit verursacht, sondern durch die Wachs- und Honigtauausscheidungen, auf denen sich Schwärzepilze ansiedeln und somit das Erntegut verunreinigen. Vorbeugende Maßnahmen: -Weite Fruchtfolge: Anbaupause von vier Jahren einhalten,Nähe von vorjährigen Kohlfeldern meiden -kein Anbau in Rapsnähe oder neben Erdbeerfeldern -sofortiges Einarbeiten befallener Kohlbestände nach der Ernte -befallsfreie Jungpflanzen verwenden, ggf. Tauchen der Jungpflanzen in zulässige Pflanzenschutzmittel -engmaschiges Kulturschutznetz (Maschenweite 0,8 x 0,8 Millimeter) zu Kulturbeginn auflegen Ernte,Aufbereitung,Vermarktung und Lagerung: Bei Weiß-,Rot- und Wirsingkohl gibt es keine leicht erkennbaren Veränderungen,die die physiologische Reife und den Beginn der Ernte anzeigen.Die Entscheidung für die Ernte basiert deshalb auf den äußeren Erscheinungsbild,auf der durch Daumendruck ermittelten Kopffestigkeit,auf dem Preisverlauf und den Möglichkeiten für den Absatz.Eine größere Rolle spielt der optimale Reifegrad für die Lagerung von Kopfkohl.Um den optimalen Erntetermin hinreichend genau zu erfassen,ist der Reifegrad ab Anfang bis Mitte Oktober mehrmals zu bestimmen.Unreif geernteter Kopfkohl welkt beim Lagern schneller,verliert seinen charakteristischen Geruch und ist anfällig gegen Fäulnisereger,während überreifer Kopfkohl geringe Lagerfähigkeit besitzt.Die Ernte von Weiß- und Rotkohl für die Lagerung beginnt im Oktober.Bei Handernte trennt man den Kohlkopf mit dem Messer vom Strunk ab und beseitigt die Umblätter.Die Kohlköpfe sind in Kisten oder im Schwad abzulegen und auf einen langsam nebenherfahrenden Schlepper mit Anhänger zu laden.Mit über 90% ist die Arbeitszeiteinsparung gegenüber der Handernte bei vollmechanisierter Ernte am größten,bei der die Arbeitsgänge Schneiden,Entfernen der Umblätter und Laden in einer kontinuierlich arbeitenden Maschine ablaufen.Bärtschi-FOBRO bietet Kohlvollerntemaschinen/Kohlernter für die Ernte von Industriekohl wie auch Frischmarktkohl zur Lagerung.Diese Kohlvollernter arbeiten absolut Beschädigungsfrei.FOBRO Kohlerntemaschinen haben eine Stundenleistung von ca. 0,1ha bei einer Geschwindigkeit von 1-3 km/h. Für das Aufbereiten von Lagerkohl stehen Putzmaschinen von NOSMA zur Verfügung,welche vergilbte und angefaulte Blätter entfernen.Vorteile bietet die NOSMA Kohlputzmaschine weil diese mit Preßluft arbeitet. Mit ihr werden die zuentfernenden Deckblätter in dem Kohlputzer abgeblasen.Mit nach diesem Prinzip arbeitenden Putzanlagen sind durchschnittliche Stundenleistungen von 10 Tonnen und mehr zu erreichen. | |
 |  |
 |